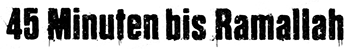Quelle: Zorrofilm
Die palästinensischen Flüchtlinge hatten weniger Glück. Die Regime der Nachbarländer hielten sie für ihre politischen Zwecke als Geiseln in den Flüchtlingscamps fest. Generationen wurden in Armut und ohne Hoffnung groß. Die Schuld gaben sie den Juden – eine traditionelle Rolle, die keinem Israeli gefiel, zumal die PLO und deren Vorsitzender Arafat die Zerstörung des Staates Israel zu ihrem Hauptziel erklärt hatte.
Ich wuchs in Jerusalem auf und unsere Wohnung war 10 Minuten zu Fuß vom arabischen Teil der Stadt entfernt. Vom Dach aus konnte ich die Mauern der Altstadt sehen. Hinüber konnte man aber nicht. Zwischen den zwei Teilen Jerusalems lag eine Grenze voller Minen.
1969, nach dem Sechs-Tage-Krieg, waren die Karten neu gemischt. Auf einmal konnten die Bewohner von Ost-Jerusalem sich frei bewegen und Geschäfte betreiben. Innerhalb von drei Jahren wurde Ost-Jerusalem zu einer lebendigen Touristenattraktion. In der Innenstadt sprachen mehr Passanten Englisch als Hebräisch. Den arabischen Bewohnern ging es gut. Damals nannten wir sie nicht Palästinenser. Sie waren einfach Araber, denn wie unsere Premierministerin Golda Meir sagte: Palästinenser, so was gibt es nicht. Sie kommen aus Jordanien und Ägypten, also sind sie Jordanier und Ägypter. So einfach machten wir es uns – und ich war überzeugt, dass sie uns für ihre Befreiung dankbar waren. Wir hatten sie aus den Flüchtlingscamps geholt und vor dem Elend gerettet. Arafat war noch immer ein Killer, aber er gehörte nicht zu diesen Menschen.
1972 ließ ich mein Auto in Wadi Josh in Ost-Jerusalem beim Automechaniker Mahmud reparieren. Ich war 24 Jahre alt und wusste so gut wie nichts über die Palästinenser. Aber Mahmud war ein guter Palästinenser, das wusste ich. Er reparierte die Autos von Juden, gut und günstig. Ich besuchte ihn oft um fünf Uhr morgens, saß neben ihm vor seiner Werkstatt und schaute ihm bei der Arbeit zu. Während ich seinen arabischen Kaffee trank, bearbeitete Mahmud ein Stück rostiges Blech mit zwei Hämmern und einem Gasbrenner. Um sieben Uhr kamen seine Arbeiter dazu. Zu dem Zeitpunkt war aus dem Blech der perfekt geformte Kotflügel eines VW Käfers geworden.
Während meiner Besuche redeten wir viel, aber es waren nie politische Gespräche. 1972 wusste ich gar nicht, dass wir, die Israelis, eine Besatzung betreiben. Daher war ich ziemlich überrascht als Mahmud mir eines Tages sagte: “Wenn die Palästinenser sich als solche definieren, und sie wollen Arafat als Anführer, warum stellen sich die Israelis dagegen? Schließlich wollen die Palästinenser nicht, dass Arafat der Präsident der Juden wird.” Zum ersten Mal bekam ich mit, dass die Araber aus Jerusalem anders denken als wir. Und tatsächlich, warum sollten wir festlegen, wer ihr Präsident wird? Wenn sie einen schlechten Menschen als Führer haben wollen, so ist das doch ihr Problem.
Viele Jahre später – ich wohnte schon in Deutschland und war zum Filmemacher und Drehbuchautor geworden – begann ich mich immer mehr für das Thema zu interessieren. Ich glaubte, und daran halte ich bis heute fest, dass ein normales Leben im Nahen Osten nur dann möglich ist, wenn die beiden Nationen sich gegenseitig voll akzeptieren. Darüber redet aber die ganze Welt seit über 60 Jahren und es ändert nichts. Da stellt sich die Frage, wie kann man heute überhaupt etwas ändern? Meine Teilantwort war: Man darf die Politik nicht zu ernst nehmen. So entstand die Idee für die Geschichte ”45 Minuten bis Ramallah”.
Ich schrieb das Drehbuch zwischen 2004 und 2011. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen zwei palästinensische Brüder aus Ost-Jerusalem. Sie wollen die sterblichen Überreste ihres Vaters über die Grenze nach Ramallah schmuggeln. Die Fahrt dauert nur 45 Minuten, doch unterwegs wird der Wagen samt Leiche gestohlen. Mit der Suche nach dem Fahrzeug und der Leiche des Vaters beginnt für die Brüder ein turbulentes Abenteuer, in dessen Verlauf sie sich sowohl mit den israelischen als auch mit den palästinensischen Autoritäten anlegen. Und die russische Autoschieber-Mafia mischt auch noch mit.
Ich habe mich selbst über die Idee amüsiert und ließ sie in meinem Freundeskreis zirkulieren. Die Kommentare ermutigten mich weiter zu schreiben. Meine Absicht war, den Film selbst in Israel zu drehen. Produzent Marek Rozenbaum, dem schon meine ältere Geschichte „Bus Stop End of the World” gefallen hatte, versuchte, den Film über den israelischen Filmfond finanzieren zu lassen. Obwohl Marek der Vorsitzender vom „Verband israelischer Produzenten“ ist, wurde das Skript abgelehnt. Man kann dafür niemandem die Schuld geben. Die Konkurrenz ist hart und wie überall suchen Investoren Sicherheit: einen bekannten Namen. Meiner war es nicht.
Ein deutscher Produzent schlug mir vor, das Buch weiter zu entwickeln und dafür eine Finanzierung bei der Filmförderungsanstalt zu beantragen. Für Geld zu arbeiten ist auch schöner. Ich holte meinem Freund Charlie Möller-Naß als Berater und zusammen schrieben wir die vierte Fassung. Charlie hatte mir schon bei dem Drehbuch „Bus Stop End of the World“ geholfen. Seine intensive Art zu beraten ist eher ein gemeinsames Schreiben. Daher entschieden wir uns später, die neue Fassungen als gemeinsames Werk zu schreiben.
Weil es mit dem Produzenten nicht so gut lief, suchte ich einen neuen. ”Brave New Work” ist eine junge Produktionsfirma in Hamburg. Sie war mir sympathisch und wir unterschrieben einen Optionsvertrag, in dem ich als Autor und Regisseur vorgesehen wurde.
Ein paar Monate später kam die gute Nachricht: Die Filmförderung Hamburg würde den Film finanzieren, wenngleich nicht mit mir als Regisseur. Wie auch der Fond in Tel Aviv wollten sie einen bekannten Namen haben. In diesem Beruf arbeiten die Autoren oft ohne Vertrag und ohne Geld. Mein letzter Vertrag lag schon weit zurück und die Kasse war leer. Um die Lage zu ändern, musste ich nur unterschreiben.
Weil ich selbst den Film nicht machen durfte, wünschte ich mir Emir Kusturica. Ein aussichtslos scheinender Wunsch, der jedoch zwei Wochen später in Erfüllung ging. Der bekannte Regisseur wollte ”45 Minuten bis Ramallah” – die alte Fassung hieß noch ”Cool Water“ - unbedingt drehen. Bald flog ich nach Serbien, um mit ihm über die Geschichte zu reden.
Kusturica ist ein überzeugender Marxist und liebt Fidel Castro. Es kommt vor, dass er mitten im Gespräch ”Viva Fidel” ruft. Dann geht das Gespräch ganz normal weiter. Er lebt in Küstendorf, ein Hotelanlage auf den serbischen Bergen. Viele kleine Holzhäuser sind in der wunderhübschen Landschaft verteilt. Dazwischen ein paar Restaurant, Musikstudio, zwei Kinos und eine kleine Kirche auf dem Hauptplatz. Ein privater Hubschrauber parkt vor seinem Haus. Alles gehört ihm. In der nahen Umgebung gibt es auch einen Skigebiet mit seinem privaten Lift, und ein Wasserkraftwerk will er auch kaufen.
Zurück in Deutschland alarmierte ich Charlie und wir schrieben eine spezial auf Kusturica zugeschnittene Fassung. Wir waren stolz auf unsere Arbeit. Auch Kusturica war zufrieden und er hatte noch ein paar neue Ideen. Nach zwei weiteren Fassungen wurde uns klar, dass es bis zum Drehbeginn so weiter gehen würde. Danach käme er bestimmt auf weitere Ideen, aber wir wären nicht mehr dabei. In den nächsten paar Monaten schrieben Charlie und ich vier weitere Fassungen. Es gab schon einen Drehtermin und daher auch Aussicht auf Geld, und nicht wenig. Uns ging es gut.
Die Produktionsfirma war weniger glücklich. Sie konnte sich mit Kusturica nicht über die Finanzierung einigen. Als es hart auf hart kam, kündigte sie ihm. Er war darüber nicht froh.
Als nächstes engagierte Brave New Work Ali Samadi, den Regisseur des Films ”Salami Aleikum“. Ali, übrigens ein sehr sympathischer Mensch, hielt sich viel mehr an das Buch als Kusturica. Aber auch Ali wollte Änderungen. Für die Produktion stand ihm ein erheblich kleineres Budget zur Verfügung. Entsprechend war auch mein Honorar viel kleiner. Der Film wurde also anders gemacht als ich es vorgesehen hatte und dabei blieb ich genauso arm wie zuvor. Da traf ich die Entscheidung, den Roman zu schreiben, denn hierbei bliebe ich der Herr über das Produkt.
Ein Israeli schreibt die Geschichte des Nahostkonflikts aus der Perspektive von zwei jungen Palästinensern. Man fragt sich, warum. „Ein Verräter“, würden manche kurzerhand sagen: Andere würden es vielleicht begrüßen, dass sich jemand in die Lage der Gegner versetzt. Genau das wäre die Empfehlung vieler Berater für die Konfliktbewältigung. Und es würden wahrscheinlich noch ein paar Meinungen dazu kommen. Daher erlaube ich mir auch meine Version zu erzählen.
Die Idee für die Geschichte ”45 Minuten bis Ramallah“ gefiel mir von Anfang an. Sie ist dramatisch und komisch zugleich, genau nach meinem Geschmack. Sie versprach viel Spaß bei der Arbeit und Ausssicht auf Erfolg. Schon zwei gute Gründe, die Geschichte zu schreiben. Die Story spielt in einer politisch aufgeladenen Region der Welt – ein weiterer Vorteil für die Vermarktung. Aber als Erzähler interessieren mich vor allem Figuren in aussichtslosen Situationen. Das sind Rafik und Jamal Abu-Raba.
Für die Recherche las ich viel, besonders die israelische Zeitung ”Haarez“ – in der Welt sehr geschätzt, in Israel oft eher verachtet. Zwei Autoren, Gideon Levi und Amira Hass, schreiben regelmäßig Anekdoten aus dem Leben der Palästinenser. Oft geht es um Banalitäten, aber durch die Besatzung und die ständigen Terrordrohungen wird das Leben der kleinen Menschen unerträglich hart. Nach und nach flossen diese Geschichten in mein Buch ein, und bevor ich wusste, was da geschah, war es nicht mehr nur eine wilde Komödie, sondern ein Drama über zwei Brüder auf der Suche nach einem normalen Leben unter nicht normalen Bedingungen. Mehr und mehr versetzte ich mich in die Lage der Protagonisten. Für einen Israeli mit meinem Hintergrund ist es nicht so einfach. In der Regel akzeptieren Israelis Kritik von eigenen Landsleuten. Aber in einem Extremfall werden diese Kritiker als Verräter gestempelt. Wenn Terroranschläge zum Alltag werden, fällt es ihnen nicht leicht über Gerechtigkeit für Palästinenser zu diskutieren. Und wenn ich es doch versuche, riskiere ich einen scharfen Kommentar, wenn nicht sogar eine Freundschaft: Wie wage ich überhaupt etwas dazu zu sagen? Ich lebe doch mit den Deutschen, im Naziland. Doch ich wagte, und die Geschichte ist weder pro Palästinenser noch Pro Israeli. Sie ist pro Menschlichkeit.
Hier Buch beim Verlag bestellen